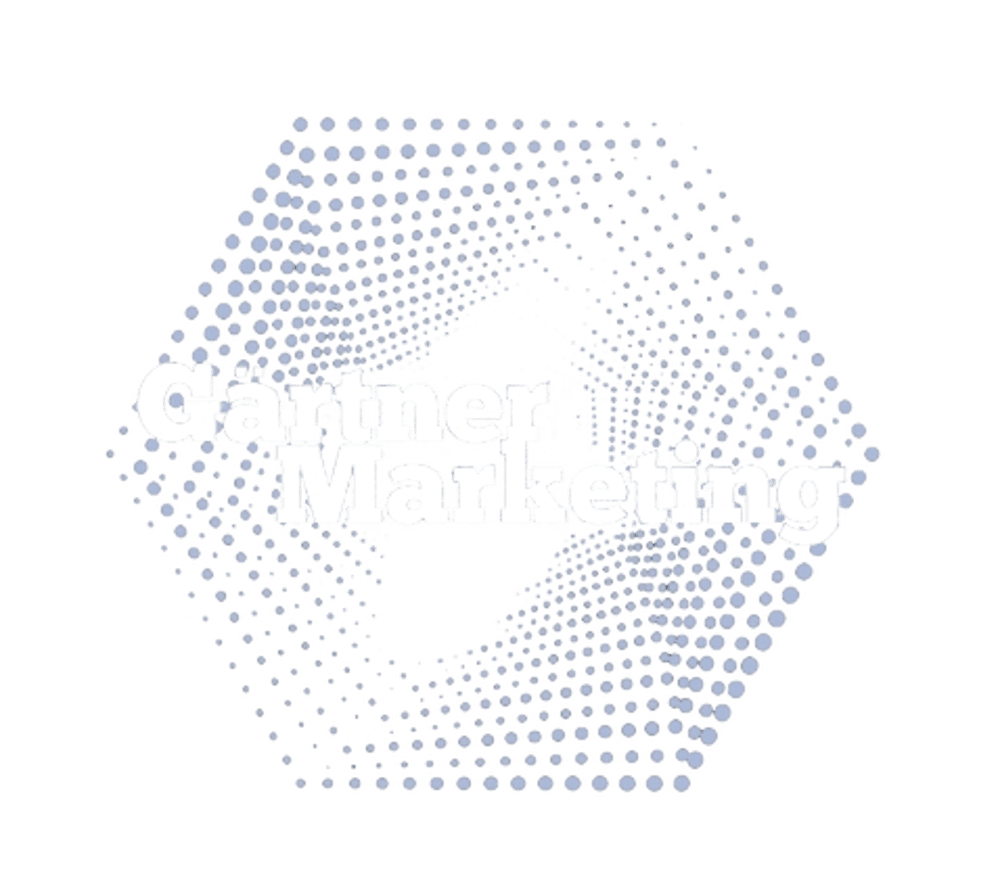Glossar Immobilienbegriffe
Abgeschlossenheitsbescheinigung: Ein behördlich ausgestelltes Dokument, das bestätigt, dass einzelne Einheiten eines Gebäudes (z. B. Wohnungen, Gewerbeeinheiten) baulich hinreichend voneinander getrennt sind. Dies bedeutet, dass jede Einheit über einen eigenen abschließbaren Zugang sowie gegebenenfalls eigene sanitäre Anlagen verfügen muss. Die Abgeschlossenheitsbescheinigung ist eine gesetzliche Voraussetzung für die Bildung von Wohnungseigentum und wird vom zuständigen Bauamt auf Antrag ausgestellt. Sie ist zudem elementarer Bestandteil der sogenannten Teilungserklärung, die beim Grundbuchamt eingereicht wird.
Abnahme: Die Abnahme ist die formelle Bestätigung durch den Bauherrn, dass das Bauvorhaben vertragsgemäß fertiggestellt wurde. Sie markiert einen wichtigen rechtlichen Zeitpunkt: Mit der Abnahme beginnt die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Baumängel. Ab diesem Zeitpunkt trägt der Bauherr auch die Gefahr für das Bauwerk. Die Abnahme kann stillschweigend, ausdrücklich oder fiktiv erfolgen (z. B. durch Ingebrauchnahme).
Abschreibung (AfA – Absetzung für Abnutzung): Die AfA ist eine steuerliche Methode, um die altersbedingte Wertminderung einer Immobilie jährlich geltend zu machen. Sie reduziert das zu versteuernde Einkommen bei vermieteten Immobilien und ist daher besonders für Kapitalanleger relevant. Der Abschreibungssatz richtet sich nach der Nutzungsdauer des Gebäudes (z. B. 2 % pro Jahr bei Neubauten). Bei denkmalgeschützten Objekten oder Sanierungen gelten teilweise höhere Sätze.
Altbau: Altbauten sind Gebäude, die vor einem bestimmten Stichtag errichtet wurden. Je nach Region kann dieser bei ca. 1949 (Nachkriegszeit) oder 1970 (vor moderner Bauweise) liegen. Typische Merkmale sind hohe Decken, Dielenböden, Holzfenster und Stuckverzierungen. Trotz ihres Charmes haben Altbauten oft energetische Schwächen und einen Sanierungsbedarf.
Ankaufsrecht: Ein vertraglich vereinbartes Recht, eine Immobilie zu einem späteren Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis kaufen zu dürfen. Das Ankaufsrecht wird oft im Zusammenhang mit Erbbaurechten, Mietkaufmodellen oder bei Investorenvereinbarungen genutzt. Es unterscheidet sich vom Vorkaufsrecht, da es nicht von einem dritten Verkaufsfall abhängt.
Annuität: Die Annuität beschreibt die gleichbleibende jährliche (oft auch monatliche) Kreditrate, die sich aus einem Zinsanteil und einem Tilgungsanteil zusammensetzt. Im Laufe der Kreditlaufzeit verschiebt sich das Verhältnis: Der Zinsanteil nimmt ab, während der Tilgungsanteil steigt. Diese Struktur bietet dem Kreditnehmer Planungssicherheit.
Annuitätendarlehen: Ein Annuitätendarlehen ist die häufigste Form der Immobilienfinanzierung. Die gleichbleibende monatliche Rate besteht aus Zins- und Tilgungsanteil. Der Vorteil liegt in der Übersichtlichkeit und Planbarkeit der monatlichen Belastung über viele Jahre hinweg.
Auflassung: Die Auflassung ist der juristische Akt der Einigung zwischen Käufer und Verkäufer über die Übertragung des Eigentums an einer Immobilie. Sie muss in Deutschland notariell beurkundet werden. Erst nach Eintragung der Auflassung ins Grundbuch erfolgt der Eigentumsübergang.
Auflassungsvormerkung: Eintrag im Grundbuch, der zugunsten des Käufers vorgenommen wird, um dessen Anspruch auf Eigentumsübertragung abzusichern. Sie verhindert, dass der Verkäufer die Immobilie ein zweites Mal verkauft oder mit Rechten belastet. Die Vormerkung bleibt bis zur finalen Eigentumsumschreibung bestehen.
Aufteilungsplan: Ein grafischer Plan, der die genaue Aufteilung eines Gebäudes in einzelne Einheiten (z. B. Wohnungen, Keller, Stellplätze) darstellt. Der Aufteilungsplan ist Bestandteil der Teilungserklärung und Voraussetzung für die Bildung von Sondereigentum.
Baubeschreibung: Ein detailliertes Dokument, das alle relevanten Informationen zu einem Bauvorhaben enthält: verwendete Materialien, Bauweise, Ausstattung, technische Standards und Bauabläufe. Die Baubeschreibung ist Bestandteil von Kauf- und Bauverträgen und dient Bauherren zur Qualitätssicherung und Planung.
Baufinanzierung: Oberbegriff für alle Finanzierungsarten im Zusammenhang mit dem Erwerb oder Bau einer Immobilie. Dazu zählen Eigenkapital, Bankdarlehen, öffentliche Fördermittel, Bausparverträge und private Darlehen. Die individuelle Kombination dieser Mittel ergibt das Finanzierungskonzept.
Baugenehmigung: Eine von der Bauaufsichtsbehörde ausgestellte Genehmigung, die die rechtliche Erlaubnis zum Bau oder zur Nutzungsänderung eines Gebäudes darstellt. Ohne diese Genehmigung sind die meisten Bauvorhaben nicht zulässig. Die Genehmigung basiert auf den geltenden Bauordnungen und Bebauungsplänen.
Bauherr: Die Person oder Institution, die ein Bauvorhaben initiiert und auf eigene Rechnung durchführt oder beauftragt. Der Bauherr trägt die Verantwortung für die Einhaltung rechtlicher Vorgaben und Sicherheitsstandards.
Bauleitplanung: Planerisches Instrument der Kommune zur Steuerung der städtebaulichen Entwicklung. Die Bauleitplanung erfolgt in zwei Stufen: dem vorbereitenden Flächennutzungsplan und dem verbindlichen Bebauungsplan. Sie regelt z. B. Nutzungsarten, Dichte und Erschließung.
Bauüberwachung: Fachliche Kontrolle eines Bauvorhabens durch Architekten oder Bauleiter. Ziel ist die Einhaltung der genehmigten Planung, der bautechnischen Standards sowie Termin- und Kostenpläne. Sie ist besonders bei komplexeren Bauvorhaben unverzichtbar.
Bebaubarkeit: Bezeichnet die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit, ein Grundstück mit einem Gebäude zu bebauen. Grundlage sind meist der Bebauungsplan oder §34 Baugesetzbuch (Innenbereich). Auch Faktoren wie Grundfläche, Erschließung und Nachbarbebauung spielen eine Rolle.
Bebauungsplan (B-Plan): Ein verbindlicher Bauleitplan, der für ein konkretes Gebiet die Art der baulichen Nutzung (z. B. Wohngebiet, Mischgebiet), das zulässige Maß (z. B. Geschossflächenzahl), Baugrenzen und Erschließungsvorgaben definiert. Der B-Plan schafft Baurecht für Bauherren.
Beleihungswert: Der vorsichtig kalkulierte Wert einer Immobilie, den Banken als Grundlage für die Kreditvergabe heranziehen. Er liegt in der Regel unter dem Verkehrswert, da Sicherheitsabschläge berücksichtigt werden. Der Beleihungswert beeinflusst die Höhe des möglichen Darlehens (Beleihungsgrenze).
Bodenwert: Der Wert des Grundstücks ohne Bebauung. Grundlage für die Bewertung ist der Bodenrichtwert, der regelmäßig von den Gutachterausschüssen ermittelt wird. Der Bodenwert ist eine wichtige Größe für Kaufpreise, Erbschaften und Besteuerung.
Brandschutz: Alle baulichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Verhinderung, Eindämmung und Bekämpfung von Bränden. Brandschutz ist in der Landesbauordnung geregelt und spielt eine zentrale Rolle bei Planung, Genehmigung und Nutzung von Gebäuden.
Courtage / Maklerprovision: Vergütung für die Tätigkeit eines Immobilienmaklers, in der Regel als prozentualer Anteil des Kaufpreises. Bei Kaufimmobilien wird sie in Deutschland seit Dezember 2020 in der Regel hälftig von Käufer und Verkäufer getragen. Bei Mietobjekten gilt das Bestellerprinzip.
Energieausweis: Ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet. Es gibt Verbrauchsausweise (basierend auf realem Energieverbrauch) und Bedarfsausweise (basierend auf berechnetem Energiebedarf). Der Ausweis ist beim Verkauf oder der Vermietung Pflicht und soll Transparenz über Energieeffizienz schaffen.
Erbpacht (Erbbaurecht): Langfristiges Nutzungsrecht (bis zu 99 Jahre) an einem Grundstück, das nicht gekauft, sondern gepachtet wird. Der Erbpächter zahlt einen Erbbauzins. Das Erbbaurecht ist vererblich, übertragbar und grundbuchlich gesichert. Nach Ablauf fällt das Gebäude an den Grundstückseigentümer.
Flurstück: Ein amtlich vermessenes Teilstück eines Grundstücks mit eindeutiger Kennzeichnung (Flurstücksnummer) im Liegenschaftskataster. Es bildet die Grundlage für das Grundbuch.
Gebäudeversicherung: Versicherungsschutz gegen Schäden an der Immobilie durch Feuer, Leitungswasser, Sturm oder Hagel. Bei finanzierten Immobilien ist sie verpflichtend. Zusätzliche Bausteine wie Elementarschadenversicherung sind möglich.
Grunddienstbarkeit: Ein im Grundbuch eingetragenes Nutzungsrecht, das einem Dritten bestimmte Handlungen auf einem Grundstück erlaubt oder verbietet (z. B. Wegerecht, Leitungsrecht). Die Dienstbarkeit "lastet" auf dem dienenden Grundstück.
Lageplan: Ein amtlicher Plan im Maßstab (z. B. 1:500), der ein Grundstück mit vorhandenen und geplanten Gebäuden zeigt. Er ist Bestandteil des Bauantrags und enthält u. a. Grenzverlauf, Nachbarbebauung und Erschließung.
Liegenschaftskataster: Amtliches Register aller Flurstücke eines Landes. Es enthält Informationen zu Lage, Nutzung, Größe, Eigentumsverhältnissen und Bebauung. Es bildet zusammen mit dem Grundbuch die Grundlage für das Liegenschaftsrecht.
Mietspiegel: Eine Übersicht über ortsübliche Vergleichsmieten für Wohnungen mit vergleichbarer Lage, Größe, Ausstattung und Baujahr. Der Mietspiegel hilft bei der Festlegung oder Anpassung von Mieten und wird in vielen Städten regelmäßig aktualisiert.
Rendite: Maß für die Wirtschaftlichkeit einer Kapitalanlage. Im Immobilienbereich ist die Bruttorendite das Verhältnis aus jährlicher Mieteinnahme und Kaufpreis. Die Nettorendite zieht Betriebs- und Finanzierungskosten ab.
Sondereigentum: Individuelles Eigentum an bestimmten Bereichen innerhalb eines gemeinschaftlich genutzten Gebäudes (z. B. eine einzelne Wohnung, Keller, Garage). Das Sondereigentum ist rechtlich vom Gemeinschaftseigentum getrennt und wird in der Teilungserklärung definiert.
Tilgung: Die Rückzahlung eines aufgenommenen Kredits in regelmäßigen Raten. Der Tilgungsanteil ist Bestandteil der monatlichen Annuität und beeinflusst Laufzeit und Restschuld.
Vermietung: Die vertraglich geregelte Überlassung einer Immobilie oder eines Teils davon an Dritte zur Nutzung gegen Mietzahlung. Der Mietvertrag legt die Rechte und Pflichten von Mieter und Vermieter fest.
Wertgutachten: Ein professionelles Gutachten, das den Verkehrswert (Marktwert) einer Immobilie durch einen sachverständigen Gutachter bestimmt. Es dient zur Preisfindung, bei Erbschaften, Scheidungen oder für Finanzierungszwecke.
Zweitwohnung: Eine Wohnung, die nicht als Hauptwohnsitz, sondern nur gelegentlich genutzt wird (z. B. Wochenendwohnung, Stadtwohnung für Pendler). In vielen Kommunen ist eine Zweitwohnung steuerpflichtig (Zweitwohnungssteuer).
Immobilien-Partner in der Region
Für einen erfolgreichen Verkauf oder Bauvorhaben arbeiten wir eng mit erfahrenen Immobilienmaklern und Bauträgern in der Region zusammen.
Unsere Partner kennen den lokalen Markt, verfügen über ein starkes Netzwerk und unterstützen Sie professionell – vom ersten Beratungsgespräch bis zum erfolgreichen Abschluss.
Kontakt
SCHWIEG IMMOBILIEN e.K.
Dahlitzer Straße 32, 03046 Cottbus
info@schwieg-immobilien.de